Das OWC-Cockpit
Liquidität und Produktivität jederzeit im Blick
Ingo Laqua, Mario Zur
Das Operating Working Capital (OWC) oder Netto-Umlaufvermögen ist eine absolute Kennzahl zur Beurteilung der Unternehmensliquidität. Gerade im heutigen Umfeld kommt dieser Kennzahl eine zentrale Bedeutung zu, bewertet sie doch, ob das Umlaufvermögen des Unternehmens ausreicht, um die kurzfristigen Verbindlichkeiten zu decken.
Eingriffsgrenzen für das OWC definieren
Das richtige Maß für das Working Capital zu
finden stellt somit die erste Herausforderung
für das Unternehmen dar. Während Forderungen
und Verbindlichkeiten noch relativ
eindeutig definiert werden können, ist ein
Lagerbestand immer in Relation zur Lieferfähigkeit
zu bewerten. Tatsache ist, dass
in Krisenzeiten das Working Capital häufig
dramatisch steigt, da sich Bestände aufgrund
nicht abgerufener Aufträge bzw. Forecasts
aufbauen und Kunden ihre Zahlungsziele in
vollem Umfang ausreizen. Aber wann ist das
Working Capital zu hoch?
Die Antwort hierauf ist u.a. von Faktoren wie Eigenkapitalquote, Markt und erforderliche Anlageninvestitionen abhängig. Basierend auf diesen Rahmenbedingungen werden Eingriffsgrenzen für das Working Capital definiert, die sich bspw. in Form der (Kapital-) Bindungsdauer oder des prozentualen Anteils vom Umsatz, Eigenkapital oder anderen Werten darstellen lassen. Hier helfen Benchmarks, um sich ein erstes Bild zu verschaffen. Bspw. beträgt die durchschnittliche Kapitalbindung in der Automobilzulieferindustrie 80 Tage, im anlagenintensiven Maschinenbau hingegen 115. Dennoch muss jedes Unternehmen für sich den optimalen Betriebspunkt und die Eingriffsgrenzen für das Working Capital definieren.

Kennzahlencockpit schafft Transparenz
Die Kennzahl Working Capital lässt sich nicht
per Knopfdruck aus einem ERP-System ziehen.
Dafür müssen die o.g. Einzelkennzahlen
aus unterschiedlichen Modulen wie Warenwirtschaft
und Rechnungswesen konsolidiert
und ggf. in Relation zu anderen Zahlen
gesetzt werden. Im operativen Geschäft ist
das Working Capital deswegen eine Zahl, die,
wenn überhaupt, nur im Monatsbericht oder
gar nicht erfasst wird.
Um dieser Kennzahl die erforderliche Beachtung zu geben, hat CIM Aachen ein Tool entwickelt, das auf Basis der in der ERP verfügbaren Daten den aktuellen Stand des OWC jederzeit abrufbar macht. Dabei ist es einerseits möglich, einen Ziel-OWC zu definieren, der bspw. auch als Kennzahl für Zielvereinbarungen herangezogen werden kann. Andererseits lassen sich die Werte der einzelnen OWC-Bestandteile darstellen, woraus der jeweilige Handlungsbedarf ersichtlich wird. Während dieser bei den Beständen noch einigermaßen transparent ist, ist das Schaffen von Transparenz im Forderungs- und Kreditorenmanagement häufig dringend erforderlich.
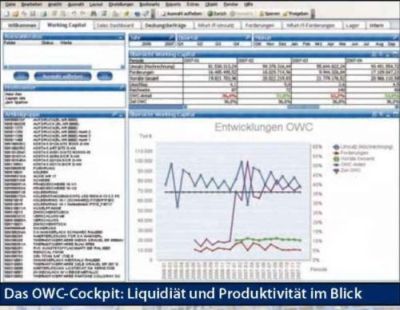
Das OWC-Tool basiert auf einer kommerziellen Softwarelösung. Deswegen lässt es sich zu einem ganzheitlichen BI-Tool (Business Intelligence) erweitern, so dass die Relation von Kennzahlen untereinander, deren zeitlicher Verlauf oder Drill-downs auf einzelne Geschäftsvorfälle möglich werden.
Sensitivitätsanalyse auf Knopfdruck
Diese Möglichkeiten bilden dann die Grundlage,
um gezielt Maßnahmen einleiten zu
können. So lassen sich bspw.
über die Entwicklung des
Bestandsbilds Potenziale in
der Disposition für einzelne
Produktgruppen identifizieren
oder die Zahlungskonditionen
für definierte Kundengruppen
optimieren. In
Verbindung mit definierten
Prozessverantwortlichen
wird somit die Grundlage für
eine gezielte Liquiditätsoptimierung
gegeben.
Interessant ist auch die Möglichkeit, über Sensitivitätsbetrachtungen zu ermitteln, welche Auswirkungen bspw. eine Reduzierung der Bindungsdauer bei Lieferantenverbindlichkeiten hat und wie sich die Freisetzung solcher liquider Mittel auf die Bilanz und GuV auswirken.
Systematik vor System
Wir bleiben unserem Grundsatz treu, nach
dem Systematik immer vor System kommt. In
diesem Fall schafft das OWC-Cockpit jedoch
eine Transparenz, die sonst nicht gegeben ist.
Das systematische Einleiten von Maßnahmen
aufgrund nachgewiesener Zusammenhänge
ist dabei der zentrale Baustein zur Sicherung
der Unternehmensliquidität.
erschienen in CIM Aktuell, 01/2009
