Integriertes Prozessmanagement
Komplexe Fertigungsprozesse stabilisieren
Ingo Laqua
Viele Unternehmen produzieren heute an ihrer vermeintlichen technologischen Kapazitätsgrenze. Diese wurde dabei schon in vielen Fällen durch erweiterte Schichtmodelle oder verlängerte Werkbänke erhöht, der steigende Auftragseingang erfordert aber weitere Maßnahmen, um nicht durch zu lange Lieferzeiten Marktanteile zu verlieren. Eine Kapazitätserweiterung kommt häufig aus finanziellen oder schlicht und einfach aus räumlichen Gründen nicht in Frage.
Umso ärgerlicher ist dann die Blindleistung solcher zum Teil kapitalintensiver Produktionskapazitäten, die durch Stillstandzeiten oder Ausschuss entsteht. Indikator für solche Blindleistungen ist der OEE (overall equipment efficiency = Anlagenverfügbarkeit x Anlagennutzung x Qualitätsrate) der den Grad der Anlagennutzung und damit unmittelbar auch die Höhe der Wertschöpfung anzeigt. Mit einem (richtig angewandten), OEE können somit sowohl technologische als auch organisatorische Problemstellungen im Fertigungsprozess identifiziert werden.
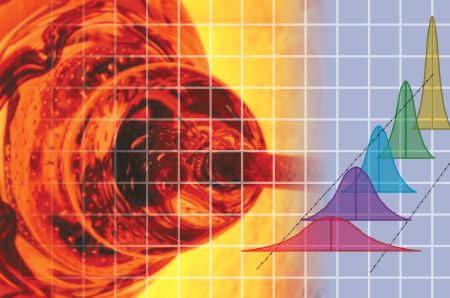
Differenzierung der Problemstellung
Im ersten Schritt gilt es somit, organisatorische
Problemstellungen zu beseitigen. Es
kann bspw. nicht sein, dass Engpässe deshalb
entstehen, weil Material nicht verfügbar ist
und eine komplexe Produktionsanlage folglich
nicht betrieben werden kann. Ebenso ist
zu organisieren, wie solche Anlagen gewartet
werden (Haben Sie schon einmal über die Kennzahl "mean time to repair" für die
Instandhaltung nachgedacht?) und wie Rüstzeiten
hauptzeitparallel organisiert werden
können.
Viel aufwendiger ist in der Regel aber die Berücksichtigung technologischer Aspekte. Instabile Prozesse verursachen nämlich nicht nur teuren Ausschuss, sondern machen die Fertigung auch nahezu unplanbar. Wenn Sie in einer Woche bspw. eine Qualitätsrate von 98% erzielen und in der Folgewoche 62%, stellt sich die Frage, mit welcher Ausschussquote Sie für die nächste Woche planen. Überkapazitäten oder Terminprobleme sind nahezu unabwendbar. Demzufolge gilt es im zweiten Schritt, den Prozess zu stabilisieren und die Qualität damit planbar zu machen. Für viele Durchschnittsunternehmen hört sich das im ersten Moment unrealistisch an, die Automobilzulieferindustrie plant aber auch mit ppm- Quoten (failure parts per million) von unter 800 Stück.
Welche Methoden wirken gegen instabile
Fertigungsprozesse?
Der unbedarfte Produktionsleiter, der sich
zur Aufgabe macht, seine Fertigungsprozesse
zu stabilisieren, findet heute in der Literatur
oder im Internet eine Reihe von Schlagwörtern,
die hier Hilfe versprechen. KAIZEN,
Six Sigma oder KVP sind hier die einschlägigen
Methoden, die zunächst einmal grundsätzlich
zur Verfügung stehen, wenn es darum
geht, Prozesse zu verbessern. Ergänzt werden
sie um Fischgrätendiagramme und FMEAs
zur Fehleranalyse oder um Instandhaltungskonzepte,
wie SPC oder Poka yoke zur Prozessoptimierung.
Die meisten dieser Methoden haben auch durchaus ihre Berechtigung, lassen aber einen wesentlichen Aspekt außen vor: Die quantifizierten Wirkzusammenhänge eines Prozessmodells. Hierbei wird festgelegt, welche Bearbeitungsparameter welchen Einfluss auf das Prozessergebnis haben und welche Wechselwirkungen untereinander bestehen. Konkret heißt das, dass zu bewerten ist, welche Auswirkungen es auf einen Prozess hat, wenn Mitarbeiter A in der Nachtschicht erst einmal alle Parameter wieder so einstellt, wie er es schon seit zehn Jahren tut.
Der zweite wesentliche Aspekt, der von vielen Methoden unberücksichtigt bleibt, ist die detaillierte Beschreibung interner Prozessspezifikationen. Spezifikationen gibt es in der Regel vom Kunden und vielleicht noch für den Lieferanten. Eine Spezifikation für den vor- oder nachgeschalteten Prozess ist dabei in den meisten Fällen die Ausnahme. Die Logik, die dahinter steckt, ist jedoch einleuchtend: Befindet sich ein Prüfkriterium vor einem bestimmten Arbeitsschritt nicht innerhalb einer bestimmten Spezifikation, so wird diese auch nicht durch den Bearbeitungsschritt selbst erreicht werden können. Das Ergebnis ist also die Veredlung von Schrott und die Belegung von Produktionskapazitäten.
Die einzige Methode, die diese wesentlichen Aspekte berücksichtigt, ist das Integrierte Prozess Management (IPM). Grundsätzliche Zielsetzung dabei ist, den Prozess zunächst mit Hilfe des Prozessmodells zu stabilisieren, wodurch ein verlässlich reproduzierbares Ergebnis (= geringere Streuung im Prozess) erzeugt wird. Im zweiten Schritt wird dann durch geeignete Maßnahmen die Produktivität unter definierten Bedingungen erhöht und somit die Qualitätsrate sukzessive optimiert.
Fazit
Eine Produktionsanlage mit einem OEE von
unter 70% ist zunächst nur ein vermeintlicher
Engpass! Sie haben alle Stellhebel in der
Hand, um organisatorisch und technologisch
entsprechende Maßnahmen einzuleiten.
Denn 70% OEE heißt gleichzeitig auch 30%
Luft nach oben. Worauf warten Sie noch?
erschienen in CIM Aktuell, 02/2007
